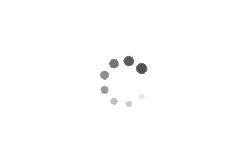In der neurologischen Rehabilitation sind individuell angepasste Hilfsmittel wie Orthesen oder Gehhilfen ein Schlüssel zur verbesserten Mobilität – und damit zur Teilhabe am Alltag. Ziel ist es, den Patient:innen ein möglichst sicheres, effizientes und selbstständiges Gehen zu ermöglichen.
Ein gelungenes Fallbeispiel zeigt: Durch eine gezielte Anpassung einer Peroneusschiene konnte das Gangbild einer Schlaganfallpatientin deutlich verbessert werden – inklusive mehr Stabilität, höherem Fußhub und besserer Sicherheit beim Gehen. Die Versorgung wurde durch funktionelle Tests (z. B. TUG, 10MWT, BBS) begleitet und auf ihre Alltagstauglichkeit angepasst.
Welche Hilfsmittel gibt es – und worauf kommt es an?
Je nach neurologischem Defizit und Therapieziel kommen unterschiedliche Orthesenformen zum Einsatz:
• Statische Orthesen (z. B. Peroneusschienen) stabilisieren das Sprunggelenk, unterstützen die Fußhebung und verbessern die Sicherheit beim Gehen.
• Dynamische Orthesen (z. B. elektronische Fußheber/Myo-Orthesen) arbeiten mit Sensoren und elektrischen Impulsen – sie sind besonders bei zentral bedingten Fußheberschwächen geeignet, aber teuer und technisch anspruchsvoll.
• Indikationsabhängige Sonderorthesen berücksichtigen komplexere Störungsbilder wie Spastik, Sensibilitätsstörungen, kognitive Einschränkungen oder Gleichgewichtsstörungen.
Wichtige Auswahlkriterien sind: Bewegungsqualität, posturale Kontrolle, Schmerzen, Kraft, Alltagssituation, Motivation – und die Ziele, die Patient:innen mit dem Hilfsmittel erreichen wollen.
Herausforderung Krankenkasse: gute Begründung zahlt sich aus
Die Genehmigung durch die Krankenkasse ist oft langwierig. Eine strukturierte Hilfsmittelverordnung mit therapeutischer Begründung, Tests und funktioneller Zielstellung verbessert die Chancen auf Genehmigung. Plattformen wie REHADAT.de oder die Leitlinie „Technische Hilfsmittel in der Neurorehabilitation“ helfen bei der Argumentation.
Wichtig in der Praxis
• Nicht jedes Gehen ist gutes Gehen – Hilfsmittel sollen physiologische Muster unterstützen, nicht kompensieren.
• Die richtige Anpassung braucht Zeit, Tests und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
• Patienten brauchen Anleitung im Alltag: Anziehen, Handhabung, Akzeptanz – besonders bei kognitiven Einschränkungen.
Fazit:
Hilfsmittel sind keine Notlösung – sondern ein wertvoller Beitrag zu Mobilität, Sicherheit und Teilhabe. Entscheidend ist die individuelle Auswahl, fundierte Testung und therapeutische Begleitung. So kann Versorgung gelingen – und Lebensqualität spürbar verbessert werden.
Artikel von J.Enders neuroreha 2022.
Zusammengefasst Baris Güngör